Geigenbau in Mailand: Übersicht
- Der alte Mailänder Geigenbau bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
- Geigenbau in Mailand: Die neue Blüte im 20. Jahrhundert
- Mailänder Geigenbauer der Gegenwart
Der alte Mailänder Geigenbau bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
Wenn der Mailänder Geigenbau in seinen Ursprüngen auch kaum mit der großen Epoche von Cremona und Brescia zu vergleichen ist – in der Meister wie Andrea und Nicolò Amati, Antonio Stradivari, Guarneri del Gesù, Gasparo da Salò und Giovanni Paolo Maggini nicht weniger als die über Jahrhunderte gültige Definition der Violine erschufen und rasch ein höchst produktives Netz überregional erfolgreicher Werkstätten entstand – reichen seine Wurzeln doch überraschend weit zurück. Zwar scheint sich im Mailand des späten 17. und 18. Jahrhunderts noch keine weit differenzierte Geigenbauszene etabliert zu haben, doch wurden die Werkstätten der Familie Grancino zum Ausgangspunkt einer Tradition, die über mehr als 100 Jahre Bestand haben sollte.
Als ihr Begründer gilt Giovanni Battista Grancino (1637–1709), der vielleicht in seinem Vater Andrea und seinem Großvater Francesco Vorläufer und Lehrmeister hatte und, soviel ist sicher, zwischen 1666 und 1685 mit seinem Bruder Francesco zusammenarbeitete. Weshalb seine Arbeiten ab der Wende zum 18. Jahrhundert einen deutlichen Einfluss der Amati-Schule erkennen lassen, ist ebenso ungeklärt wie die Identität zweier weiterer Träger seines Namens, die in der Forschung zeitweise als seine Nachkommen und Schüler identifiziert wurden; denkbar ist allerdings auch, dass Giovanni Battista „I.“ erst im hohen Alter von rund 90 Jahren starb und es sich bei allen um dieselbe Person handelte.
Wenn seine Arbeiten auch zuweilen etwas einfachere Standards etwa in der Holzwahl erkennen lassen – woraus sich wohl Rückschlüsse auf die Marktbedingungen im Mailand seiner Zeit ziehen lassen – sind gerade die späteren Instrumente der Grancino-Werkstatt bis heute gefragte, klangstarke Instrumente, und der hohe Anteil von Violoncelli in seinem Gesamtwerk begründet den hohen Rang Grancinos in der Geschichte dieser Disziplin. 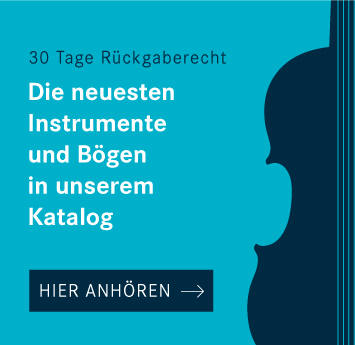
Unter den Schülern von Giovanni Battista Grancino, zu denen interessante Meister wie Santino Lavazza, Gaetano Pasta und vermutlich auch dessen Vater Bartolomeo Pasta, Carlo Rotta und Ferdinando Alberti gehören, gebührt der Rang als legitimer Erbe der Grancino-Tradition wohl doch am meisten dem großen Carlo Giuseppe Testore (ca. 1660–1716). Sein Werk, das wie das seines Lehrers nicht zuletzt für hervorragende Celli berühmt ist, reflektiert den Stil Grancinos, ohne eine starke persönliche Note vermissen zu lassen. In ihr entwickelte sich der ältere Mailänder Stil weiter und fand in Carlo Giuseppes Sohn Carlo Antonio Testore (1693 – ca. 1765) und seinem Sohn Giovanni Testore (1724–1765) treue Bewahrer. Ungeachtet der vorzüglichen Fähigkeiten insbesondere Carlo Antonios lassen einige Instrumente seiner Werkstatt doch erkennen, dass er, wie zuvor Grancino, nicht immer für die zahlungskräftigsten Kunden arbeiten konnte und deshalb zu mancher, vor allem ästhetischen Konzession gezwungen war. Diese Umstände scheinen noch mehr die Arbeit seines Bruders Paolo Antonio Testore (ca. 1690 – ca. 1750) belastet zu haben, der aber, wie auch sein Sohn Gennaro Testore (ca. 1735 – ca. 1800), selbst aus minderwertigen Hölzern tragend und schön klingende Instrumente fertigte.
Eine gewisse Rolle mag auch eine wachsende Konkurrenz gespielt zu haben, die sich durch den kurzen Aufenthalt von Giovanni Battista Guadagnini in Mailand und durch den Aufstieg der Geigenbauerfamilie Landolfi ergab. Zwar arbeitete Guadagnini nur zwischen 1750 und 58 in Mailand, um anschließend über Cremona und Parma nach Turin zu wandern, wo er gemeinsam mit dem Grafen Cozio di Salabue Musikinstrumentengeschichte schreiben sollte. Doch selbst diese kurze Zeit scheint genügt zu haben, um nachhaltige Wirkung auf den lokalen Markt für Streichinstrumente zu entfalten, für die nicht zuletzt das Werk von Carlo Ferdinando Landolfi (ca. 1710–1784) steht. Seine Arbeiten lassen eine klare Inspiration, vielleicht sogar eine Ausbildung durch Guadagnini erkennen, und diese Unabhängigkeit von der alten Mailänder Tradition der Familien Grancino und Testore brachte eine zuvor unbekannte Vielfalt in den Mailänder Geigenbau. Schulbildend wirkte Carlo Ferdinando Landolfi durch seinen Sohn Pietro Antonio Landolfi (ca. 1730–1795), mehr aber noch durch die Geigenbauer der Familie Mantegazza, die entscheidend dazu beitrugen, dass der Geigenbau in Mailand in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts eine gewisse Blüte erlebte. So arbeiteten in der Werkstatt des Landolfi-Schülers Pietro Giovanni Mantegazza (ca. 1730–1803) wohl bis zu fünf weitere Mitglieder der Familie, deren genaue verwandtschaftliche Beziehungen der Forschung bis heute ungelöste Rätsel aufgeben. Gut bekannt ist hingegen die Basis ihres wirtschaftlichen Erfolgs: die umfangreiche Zusammenarbeit mit dem Grafen Cozio di Salabue, der zahlreiche altitalienische Meisterviolinen von den Mantegazzas „modernisieren“ ließ. Offenkundig vollendeten sie auch viele Violinen aus dem Nachlass Giovanni Battista Guadagninis, die Cozio seinem Turiner Partner im großen Stil abgekauft hatte.
Geigenbau in Mailand: Die neue Blüte im 20. Jahrhundert
Aus unbekannten Gründen fanden die Traditionslinien Grancino–Testore und Guadagnini–Landolfi–Mantegazza im jungen 19. Jahrhundert keine Fortsetzung; zwar kam der Geigenbau in Mailand in den folgenden Jahrzehnten keineswegs zum Erliegen, doch sollte es fast ein Jahrhundert dauern, bis Mailänder Werkstätten wieder überregionale Strahlkraft entfalten konnten.
Das Feld bereiteten kleinere Ateliers, von denen einige gute Instrumente herstellten, ohne jedoch selbst in irgendeiner Weise prägend oder schulbildend zu wirken – und das um 1750 gegründete Unternehmen Monzino, das mit dem Bau und dem Vertrieb von Zupfinstrumenten international erfolgreich geworden war und wohl unter der Führung von Giacomo Antonio II. Monzino (1772–1854) begann, sich auch dem Streichinstrumentenbau zuzuwenden.
Wie die Monzino-Werkstatt zog gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch Leandro Bisiach (1864–1946) exzellente Geigenbauer nach Mailand, darunter sein Lehrer Riccardo Antoniazzi (1853–1912), der es mit seiner eigenen Werkstatt in den Jahren 1870–80, als Mitarbeiter Bisiachs von 1886–1904 und anschließend im Hause Monzino auf drei Werkperioden brachte, die, in ganz eigenen Kontexten, alle von hohen geigenbauerischen Ansprüchen bestimmt waren. So versammelten sich im frühen 20. Jahrhundert erfahrene, innovative Meister in Mailand, als wollten sie die 100 Jahre zuvor abgebrochene Tradition fortsetzen: Neben den Söhnen von Leandro Bisiach – Andrea Bisiach (1890–1967), Carlo Bisiach (1892–1968), Giacomo Bisiach (1900–1995) und Leandro II. Bisiach (1904–1982) – ist Gaetano Sgarabotto (1878–1959) zu nennen, der sich mit Unterstützung von Antoniazzi und Leandro Bisiach autodidaktisch zu einem vielfach ausgezeichneten Meister bildete, sowie Luigi Galimberti (1888–1957), Ambrogio Sironi (1902–1939) und Raffaelo Bozzi (1905–1981).
Neben Bisiach etablierte sich ab 1900 Celeste Farotti (1864–1928) in Mailand, ein ebenfalls hochtalentierter Geigenbauer, der aus derselben Gegend wie Leandro Bisiach stammte und sich mit anspruchsvollen Reparaturen rasch einen Namen machte. Zu einer wahren Konkurrenz für den nur zwei Monate jüngeren Bisiach avancierte Farotti, als er sich, durch die Erfolge ermutigt, dem Neubau zuwandte und einen Stil etablierte, der mit seiner Orientierung an Giovanni Francesco Pressenda und Giuseppe Rocca in einem interessanten Kontrast zur sich herausbildenden neuen Mailänder Schule stand. Unterstützt wurde er von Alfred Lanini (1891–1956), dessen Lehre bei Antoniazzi durch den frühen Tod des Meisters abrupt beendet wurde und der nach seiner Zeit bei Farotti in seiner kalifornischen Heimat als überaus produktiver und experimenteller Meister arbeitete, sowie von seinem Neffen Celestino Farotto (1905–1988), der nach dem zweiten Weltkrieg auch für Bisiach tätig war und für sein umfangreiches Werk zahlreiche Auszeichnungen erhielt.
Mailänder Geigenbauer der Gegenwart
Nicht zuletzt durch die Civica Scuola di Liuteria di Milano, die 1978 gegründete Geigenbauschule, beansprucht Mailand heute einen festen Platz in der Welt des Geigenbaus. Doch auch außerhalb der Lehrwerkstätten hat sich eine überschaubare, aber lebendige und interessante Geigenbauerszene etabliert, die an die Impulse des neuen Mailänder Geigenbaus anknüpft.
Das prominenteste Beispiel für diese Kontinuität ist ohne Frage der Geigenbauer Nicola Enrico Antonio Monzino (1970–), mit dem die Tradition dieses renommierten Familienunternehmens ihr 250. Jahr schon weit überschritten hat. Im Sinne seines Großvaters Antonio VI. Carlo Monzino (1909–2004) versteht er der Erbe dieser langen Reihe erfolgreicher Unternehmer und Geigenbauer seine Werkstatt als ein Studio klassischer geigenbauerischer Exzellenz – als ein neues „Laboratorio Monzino“.
Eng verbunden mit den Institutionen des Mailänder Musiklebens ist Delfi Merlo (1961–), der seine Laufbahn 1977 als Lehrling bei Monzino begann und einige Jahre später eine klassische Geigenbau-Ausbildung an der Scuola di Liuteria in Cremona absolvierte. Nach der Eröffnung seiner Werkstatt erhielt er Restaurierungs-Aufträge des Musikinstrumentenmuseums im Mailänder Castello Sforzesco und arbeitete für das Konservatorium sowie für das berühmte Teatro alla Scala. Seit den frühen 1990er Jahren hat er sich zudem einen guten internationalen Ruf mit neu gebauten Instrumenten erworben.
Zu den jüngeren Absolventen der Mailänder Geigenbauschule gehört Lorenzo Rossi, der während seines Physikstudiums die Liebe zum Geigenbau entdeckte und sich seit seinem Abschluss in zahlreichen Kursen bei internationalen Meistern wie Carlos Arcieri und Guy Rabut weitergebildet hat, nicht zuletzt in modernsten Techniken der Restaurierung. Für seine Instrumente wurde er mehrfach auf renommierten Ausstellungen wie dem Concorso Triennale Internazionale die Liuteria Antonio Stradivari ausgezeichnet.
Andere, nicht weniger interessante Akzente setzt Stefano Bertoli, der ebenfalls an der Mailänder Schule lernte und seither eine enge Zusammenarbeit mit Carlo Chiesa pflegt – einem weiteren Absolventen derselben Schule, der mit Bertoli ein besonderes Interesse an klassischen, handwerklichen Techniken teilt und ihn zu einer vertieften Beschäftigung mit der Kunst der Holzschnitzerei inspiriert hat.





