Dass der Geigenbau in Wien auf eine ausgesprochen lange Geschichte zurückblickt und Wiener Lauten- und Geigenbauer seit dem späten 14. Jahrhundert namentlich bekannt sind belegt den musikhistorischen Rang, den die österreichische Donaumetropole bereits Jahrhunderte vor der Zeit Haydns und Mozarts beanspruchen konnte. Wurde die Wiener Musikkultur des Spätmittelalters nicht zuletzt durch die zu Wohlstand gelangten Bürger der Handelsstadt getragen, fand der Geigenbau auch nach dem Aufstieg Wiens zur habsburgischen Residenz beste Voraussetzungen vor – eine Situation, die in ihren Grundzügen bis zum Ende des 1. Weltkriegs bestehen bleiben und die Geschichte des Wiener Geigenbaus prägen sollte.
Der Geigenbau in Wien, Übersicht:
- Die Wiener Schule des Geigenbaus im 17. und 18. Jahrhundert
- Der begrenzte Einfluss italienischer Modelle auf den Geigenbau in Wien
- Die neue Wiener Schule und der industrielle Geigenbau in der Habsburgermonarchie
- Wiener Geigenbau zwischen Handwerk und Manufakturwesen
- Zeitgenössischer Geigenbau in Wien
- Wiederbelebung des Geigenbaus in Wien
Die Wiener Schule des Geigenbaus im 17. und 18. Jahrhundert
Vor dem Hintergrund des reichen Musiklebens in der aufblühenden Residenzstadt mag verwundern, dass der Wiener Geigenbau im 17. und 18. Jahrhundert keine eigenständige Tradition ausgebildet hat, sondern zur wohl authentischsten Repräsentanz des Füssener Stils in Europa avancierte. 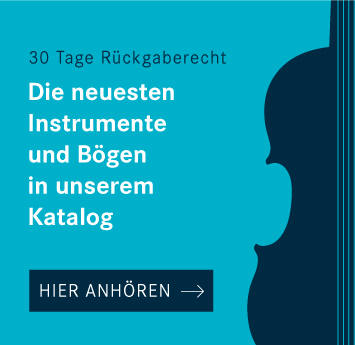 Spätestens im 17. Jahrhundert ist der dominante Einfluss Füssens auf den Geigenbau in Wien mit den Namen zahlreicher Meister dokumentiert, die sich im Umfeld der 1498 gegründeten Wiener Hofkapelle, der vielfältigen kammermusikalischen Ensembles und der Adelskapellen niederließen – nicht selten, um Handwerkerdynastien zu gründen, von denen einige über Generationen florierten. Zu ihnen gehören der spätestens seit 1630 in Wien tätige Thomas Epp und sein Schwiegersohn Magnus Feldtle (auch: Veltl, Feltl), in den folgenden beiden Generationen die Brüder Mathias Fux und Johann Jakob Fux, Andreas Bär (Beer) sowie die Geigenbauer der Familie Hollmayr.
Spätestens im 17. Jahrhundert ist der dominante Einfluss Füssens auf den Geigenbau in Wien mit den Namen zahlreicher Meister dokumentiert, die sich im Umfeld der 1498 gegründeten Wiener Hofkapelle, der vielfältigen kammermusikalischen Ensembles und der Adelskapellen niederließen – nicht selten, um Handwerkerdynastien zu gründen, von denen einige über Generationen florierten. Zu ihnen gehören der spätestens seit 1630 in Wien tätige Thomas Epp und sein Schwiegersohn Magnus Feldtle (auch: Veltl, Feltl), in den folgenden beiden Generationen die Brüder Mathias Fux und Johann Jakob Fux, Andreas Bär (Beer) sowie die Geigenbauer der Familie Hollmayr.
Der begrenzte Einfluss italienischer Modelle auf den Geigenbau in Wien
Mit der Gründung der Lauten- und Geigenmacher-Innung im Jahr 1696 erreichte der Wiener Geigenbau auch institutionell eine neue Stufe seiner Entwicklung, und obwohl die Stadt rasch zu einem maßgeblichen europäischen Kultur- und Musikzentrum wurde, nahmen ihre Geigenbauer von den bahnbrechenden Innovationen der altitalienischen Meister über das gesamte 18. Jahrhundert zunächst kaum Notiz. So kam das Geigenmodell von Antonio Stradivari vergleichsweise spät in Wien an, und Meister wie Andreas Leeb, Mathias Thier, Sebastian Dallinger und Michael Ignaz Stadlmann stehen exemplarisch für den bestimmenden Einfluss der süddeutschen, tirolischen Schule – aus der, als eines ihrer prominentesten Instrumente, auch die berühmte Mozart-Violine stammt, die vermutlich in Mittenwald als eine bis zum Etikett getreu nachgeahmte Stainer-Geige gebaut wurde. Allein Nikolaus Leidolf, der im Unterschied zu einem großen Teil seiner Zeitgenossen nicht aus Füssen, sondern vermutlich aus der Schweiz stammte, war ein einsamer Repräsentant des italienischen, an Testore orientierten Geigenbaus im Wien des frühen 18. Jahrhunderts. Diese konservative Orientierung der alten Wiener Geigenbauschule sollte allerdings – inklusive instrumentengeschichtlicher Besonderheiten wie dem Baryton oder fünfsaitigen, mit Bünden versehenen Kontrabässen, die sich in Wien anhaltender Beliebtheit erfreuten – nicht als skurriler Anachronismus gesehen werden; vielmehr entsprach das Klangideal der Stainer-Tradition den Bedürfnissen der vorwiegend höfischen Musikkultur mit ihrer starken kammermusikalischen Ausrichtung perfekt.
Die neue Wiener Schule und der industrielle Geigenbau in der Habsburgermonarchie
Für den Übergang zum neueren Standard der Wiener Schule stehen neben Franz Geissenhof, in dessen Werk die italienischen Bauprinzipien ab der Wende zum 19. Jahrhundert in besonders klarer Ausprägung Einzug halten, die Geigenbauer Michael Ignaz Stadlmann, Johann Martin Stoss und Carl Nicolaus Sawicki (Savicki), die zu den besten Meistern ihrer Generation zählen, gefolgt von den kaum geringeren Matthäus Ignaz Brandstätter, Gabriel Lemböck, Anton Hofmann und seinem Schüler Wilhelm Theodor Gutermann.
Daneben ist der Wiener Geigenbau im 19. Jahrhundert geprägt durch zunehmende Wechselwirkungen mit den anderen Zentren des Kaisertums Österreich, insbesondere in Böhmen und Ungarn. Ihr wichtigster Exponent ist der Geissenhof-Schüler Johann Baptist Schweitzer, der sich 1825 in Pest niederließ und für die herausragende musikalische Qualität seiner Instrumente weit über seine Wahlheimat und über seinen Tod hinaus berühmt wurde. Nicht allein durch sein persönliches Werk, sondern auch als Lehrer vieler exzellenter Meister hat er den Geigenbau seiner Zeit erheblich beeinflusst.
Wiener Geigenbau zwischen Handwerk und Manufakturwesen
Zugleich eroberten die Manufakturen in Schönbach und Graslitz im Lauf des 19. Jahrhunderts auch Marktanteile in Wien und sorgten auf ihre Weise dafür, dass der Wiener Geigenbau im 19. Jahrhundert eine starke handwerkliche Orientierung behielt – indem sie die Nachfrage nach günstigen Instrumenten weitgehend lückenlos bedienten, sodass sich ein industrieller Streichinstrumentenbau in Wien zunächst nicht etablieren konnte. Dem widerspricht in keiner Weise, dass auch respektable, gut ausgebildete Meister wie Franz Hoyer und sein Schüler Ignaz Lutz den Weg von Schönbach nach Wien fanden – und dort nicht nur anerkannte Werkstätten eröffneten, sondern auch als Brückenbauer für vielfältige Geschäftsbeziehungen zwischen dem Vogtland und der Hauptstadt wirkten.
Zeitgenössischer Geigenbau in Wien
In der Zeit nach den Weltkriegen erlebte der Wiener Geigenbau eine Stagnation, die der schlechten wirtschaftlichen Situation, aber auch globalen Veränderungen des Marktes geschuldet waren; sowohl die Musikindustrie als auch der Handel mit historischen Spitzeninstrumenten – und mit ihm die Nachfrage hochwertiger Restaurierungsleistungen – veränderten sich innerhalb der geopolitischen Rahmenbedingungen, und dies nicht zum Vorteil des Wiener Geigenbaus.
Wiederbelebung des Geigenbaus in Wien
Ein neu erwachtes Interesse an traditionellen Instrumenten des Alpenraums und die Belebung der historischen Aufführungspraxis führten jedoch seit den 1980er Jahren zu einer langsamen Wiederbelebung des Geigenbaus in Wien, sodass die Stadt heute eine neue, hochinteressante Szene handwerklicher Geigenbauwerkstätten vorzuweisen hat. Zu ihr gehören meist international ausgebildete Meister wie Carl von Stietencron, Gerlinde Reutterer, Julia Maria Pasch, Marcel Richters und Hans Rombach.





